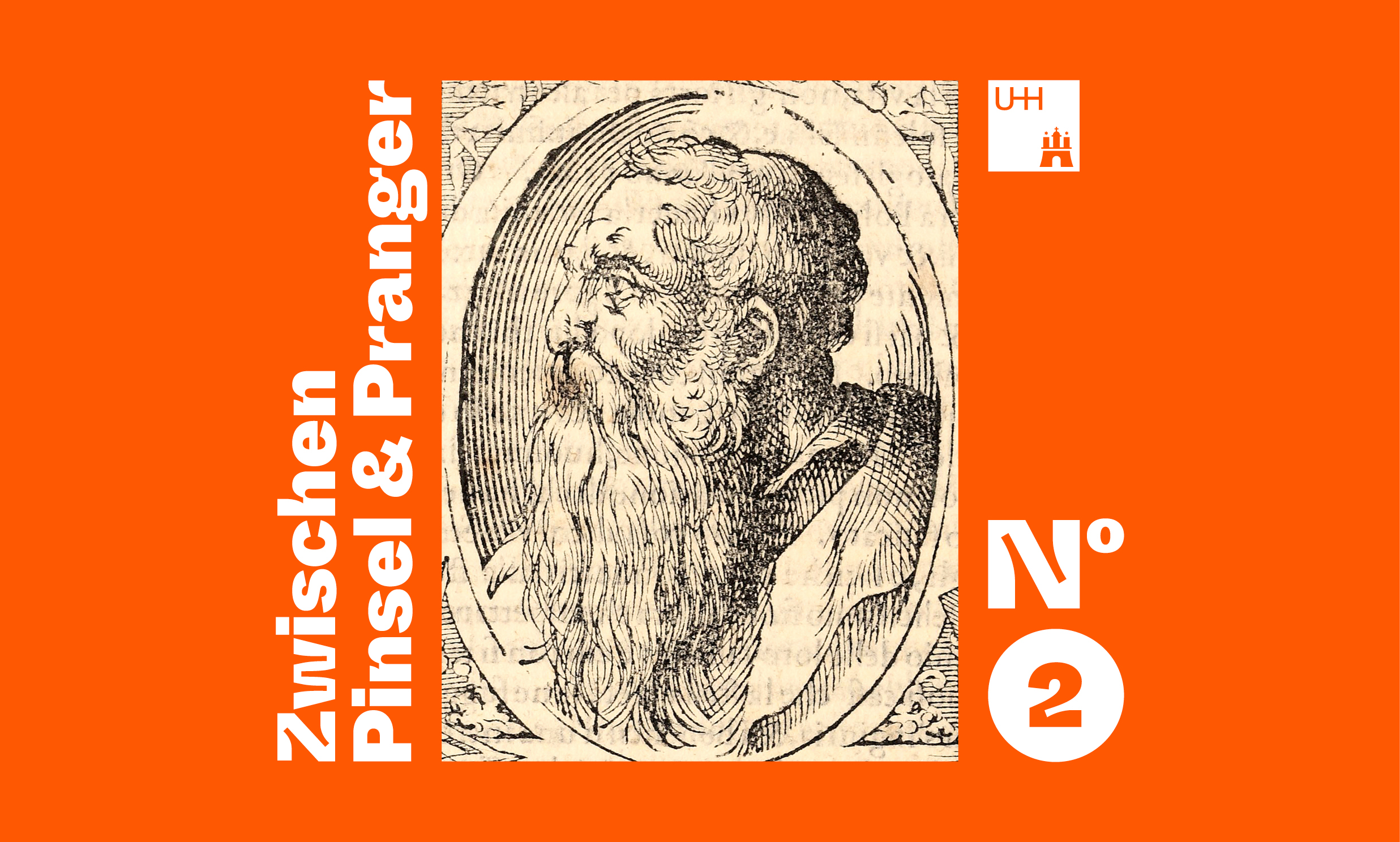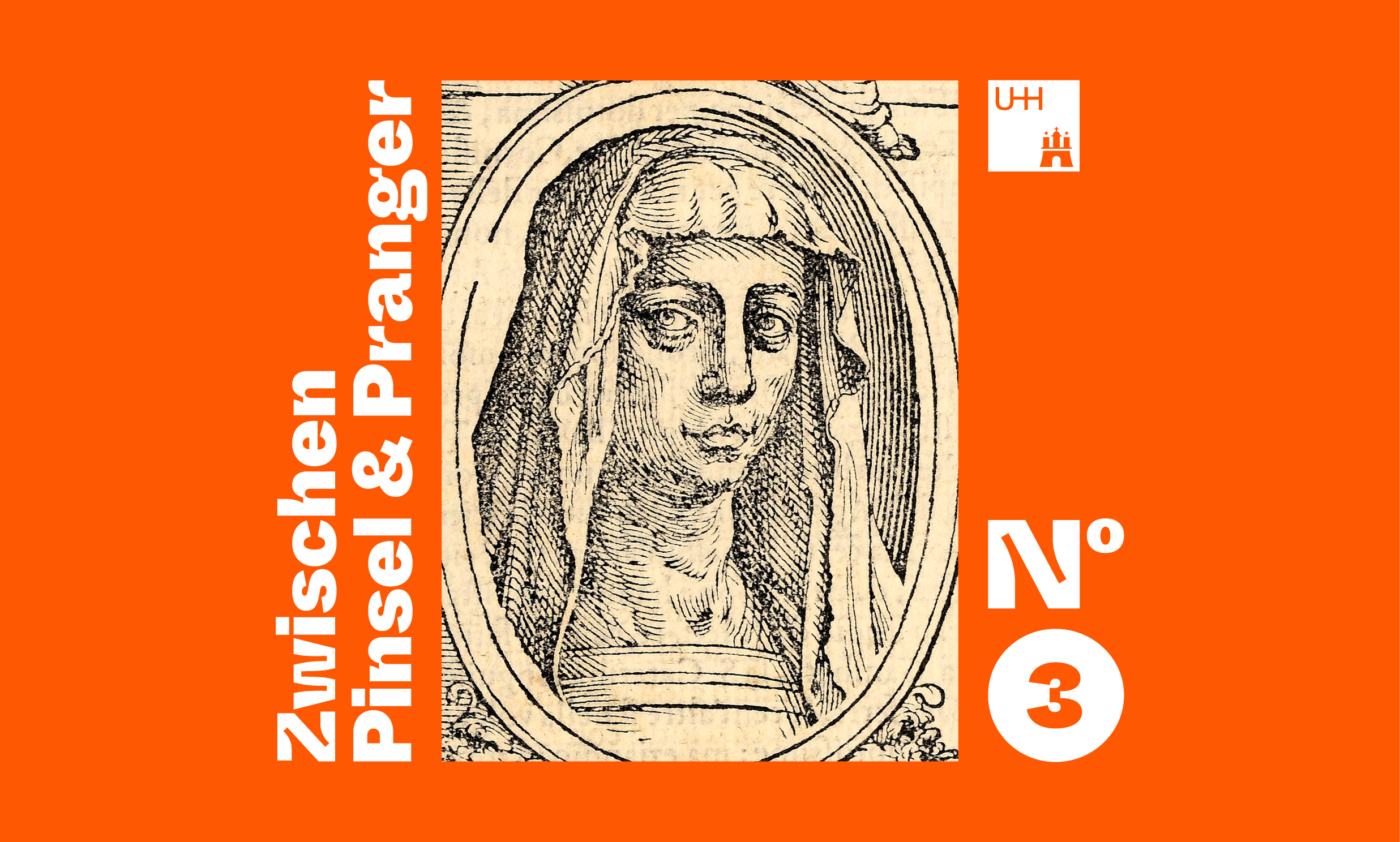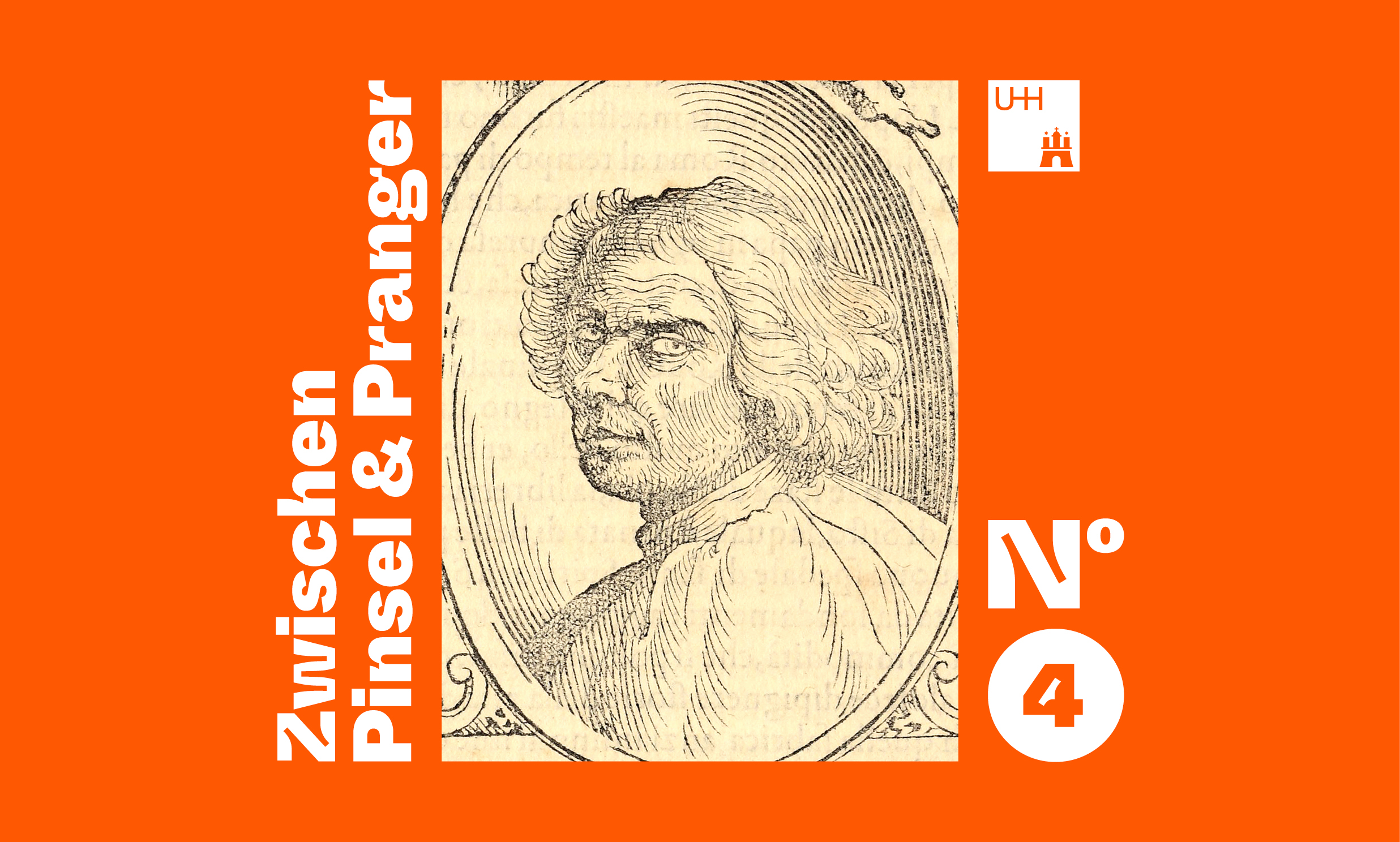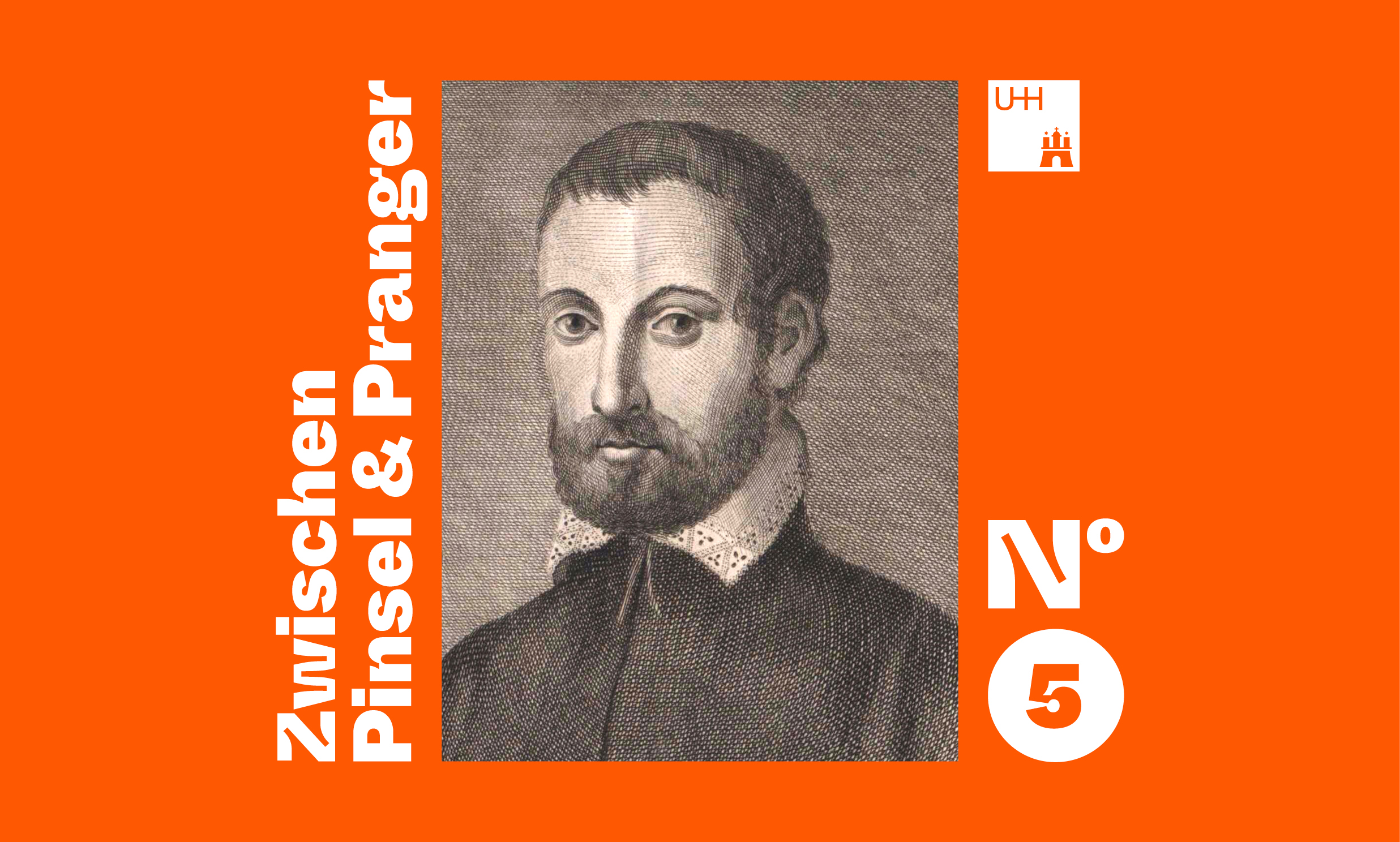PODCAST Zwischen Pinsel & Pranger
Zwischen Pinsel und Pranger - Ein Podcast über Kunst und Moral im Italien der Frühen Neuzeit
„Zwischen Pinsel und Pranger“ ist ein Lehrprojekt des Kunstgeschichtlichen Seminars der Universität Hamburg unter der Leitung von Dr. Jana Graul
Worum geht's?
„Zwischen Pinsel und Pranger“ handelt von der künstlerischen Freiheit und ihren Grenzen im Italien des 15. bis 17. Jahrhunderts. In acht Folgen werden erfolgreiche Künstler*innen vorgestellt, die sich nicht an die Regeln hielten und deren Lebenswandel oder Tun mit den Moralvorstellungen ihrer Zeit kollidierte, z.B. weil sie Geschlechterbilder hinterfragten, provozierten, spielsüchtig waren, neidisch, aggressiv, leidenschaftlich, gewalttätig, dem Alkoholkonsum zugeneigt oder schlichtweg, weil sie sich das Leben nahmen. Jede Folge behandelt eine:n Künstler: in und ein Vergehen. Es wird beleuchtet, wo genau seinerzeit überhaupt jeweils die Grenzen des moralisch Erlaubten lagen und wie streng man bei ihrer Überschreitung mit Künstler*innen umging. Traten Moralversagen und Kunstschaffen in Beziehung? Und wie sah man das damals: lassen sich Werk und Künstler*in trennen?
Teaser
Ein besonderes Highlight des Wissenschaftspodcasts sind Interviews mit renommierten Expertinnen und Experten, die die Folgenthemen einordnen sowie Originalzitate, die das Denken im Italien der Frühen Neuzeit nahebringen. Außerdem wurden einzelne Folgen durch eigens für uns vom Miskatonic Thematerensemble eingespielte Hörspielelemente bereichert (allen Beteiligten gilt hierfür unser großer Dank!).
Der Podcast erscheint 14-tägig auf dem Wissenschaftsportal der Gerda-Henkel-Stiftung L.I.S.A. Er ist jetzt unter https://lisa.gerda-henkel-stiftung.de/podcastreihe_zwischen_pinsel_und_pranger zu finden und in Kürze auch auf dieser Website sowie überall, wo es Podcasts gibt.
Idee und Konzept des Podcasts stammen von Dr. Jana Graul, zusammen mit den Studierenden Annett Beyer, Vincent Ellmers, Annika Hüther, Joana Laura Noack, Tobias Techen, Darius Wakilzadeh, Joachim H. Weihe und Katrin Lieselotte Witt.
Das Lehrprojekt wurde sehr engagiert durch Dr. Mirjam Schubert vom Schreibzentrum der Universität Hamburg und Paul Voigt, Technischer Leiter des Medienzentrums der Fachbereiche Sprache, Literatur, Medien I + II begleitet.
Unterstützt und gefördert von


Credits:
Wissenschaftliche Betreuung und Redaktion: Dr. Jana Graul
Technische Betreuung: Vincent Ellmers und Paul Voigt
Ton, Technik und Schnitt: Vincent Ellmers, Sven Remer und Paul Voigt sowie die Autorinnen und Autoren der einzelnen Folgen
Grafik: Darius Wakilzadeh
Wissenschaftsjournalistische Beratung bzw. Trainings: Georgios Chatzoudis und Christiane Zwick
Konzept und Herstellung Teaser: Vincent Ellmers und Annika Hüther
Sprecher Intro: Vincent Ellmers
Musik Intro: Tobias Hume (1569-1645), A Merry Meeting. Stefano Zanobini, Viola d’Amore. Mit freundlicher Genehmigung von NovAntiqua Records. Album verfügbar auf: https://www.novantiqua.net/prodotto/A-Question-an-Answer
Folge 1
Frech & Frevelhaft. Der selbsternannte „Sodomit“ Giovanni Antonio Bazzi
Zwischen Pinsel und Pranger | Ein Podcast über Kunst und Moral im Italien der Frühen Neuzeit
Ein Künstler, der sich selbst „der Sodomit“ nennt – ausgerechnet in der italienischen Renaissance? Was wie ein Skandal klingt, war tatsächlich ein Statement – provokant, verspielt und queer? Giovanni Antonio Bazzi, genannt Il Sodoma, war ein Meister der Selbstinszenierung. Zwischen Pferderennen, Fresken und tierischen Begleitern hinterfragt er mit Witz und Stil gängige Männlichkeitsbilder. Dies bleibt allerdings nicht ohne Kritik. Vor allem der Künstlerbiograph Vasari hat zu Sodomas Lebensweise und deshalb auch zu seiner Kunst eine klare Meinung. Diese Folge taucht ein in die Welt der italienischen Hochrenaissance, wo gleichgeschlechtliches Begehren sichtbar – und zugleich verfolgt – war.
Anhören:
Kurzbiographie des Künstlers
Giovanni Antonio Bazzi wurde um 1477 in Vercelli geboren. Seine künstlerische Ausbildung erhielt er vermutlich in der lombardischen Schule, bevor er um 1501 nach Siena übersiedelte. Dort etablierte er sich rasch als einer der führenden Maler der Region. Ab 1508 war er in Rom tätig, wo er unter anderem an der Ausmalung der Villa Farnesina mitwirkte und Aufträge im Vatikan erhielt. Zu seinen bedeutendsten Werken zählen die Fresken im Kloster Monte Oliveto Maggiore in Asciano (1497-1506), in der Villa Farnesina in Rom (1519) sowie in der Kirche San Francesco in Siena (1510). Bazzi wurde 1515 von Papst Leo X. zum Ritter geschlagen. In der Folge war er überwiegend in Siena tätig, wo er bis zu seinem Tod im Jahr 1549 eine produktive Werkstatt führte. Sein künstlerisches Œuvre umfasst religiöse wie mythologische Themen und ist geprägt von Einflüssen der oberitalienischen und römischen Hochrenaissance. Der Beiname Il Sodoma, unter dem er bereits zu Lebzeiten bekannt war, ist historisch belegt; seine Herkunft und Bedeutung in der zeitgenössischen Wahrnehmung sind jedoch umstritten.
Weiterführende Literatur
- Bartalini, Roberto, Alessia Zombardo: Giovanni Antonio Bazzi, il Sodoma: fonti documentarie e letterarie, Vercelli 2012.
- Lemelsen, Katja: „Einleitung zum Leben des Sodoma“ in: Giorgio Vasari. Sodoma und Beccafumi. Neu übersetzt und kommentiert, hrsg. v. Sabine Feser/Matteo Burioni/Katja Lemelsen, Berlin 2006, S. 7‑10.
- Lemelsen, Katja: „Anmerkungen zum Leben des Sodoma“ in: Giorgio Vasari. Sodoma und Beccafumi. Neu übersetzt und kommentiert, hrsg. v. Sabine Feser/Matteo Burioni/Katja Lemelsen, Berlin 2006, S. 75‑97.
- Klinkert, Thomas: „Gleichgeschlechtliche Liebe ׀ Sodomie“, in: Liebessemantik: frühneuzeitliche Darstellungen von Liebe in Italien und Frankreich, hrsg. v. Kirstin Dickhaut, Wiesbaden 2014, S. 477‑516.
- Kondziella, Martha: Sodoma: die Tafel- und Leinwandbilder, Merzhausen 2023.
- Pfisterer, Ulrich: Lysippus und seine Freunde: Liebesgaben und Gedächtnis im Rom der Renaissance oder Das erste Jahrhundert der Medaille, Berlin 2008.
- Saslow, James M.: „Gianantonio Bazzi, called ‘il Sodoma’. Homosexuality in art, life and history”, in: Sex, Gender and Sexuality in Renaissance Italy, hrsg. v. Jacqueline Murray/Nicholas Terpstra, London/New York 2019, S. 183‑210.
Quellen
- Giorgio Vasari: Le vite dei più eccellenti pittori, scultori e architetti (1550/1568), hrsg. v. Rosanna Bettarini/Paola Barocchi, Florenz 1966‑1997.
- Giorgio Vasari: „Das Leben des Malers Giovan Antonio, genannt Sodoma aus Vercelli“ in: Giorgio Vasari. Sodoma und Beccafumi. Neu übersetzt und kommentiert, hrsg. v. Sabine Feser/Matteo Burioni/Katja Lemelsen, Berlin 2006, S. 11‑42.
- Accademia della Crusca „Somddomia“ in: Vocabolario degli Accademici della Crusca, Florenz, 1691, S. 1542.
- Roberto Bartalini, Alessia Zombardo: Giovanni Antonio Bazzi: il Sodoma: fonti documentarie e letterarie, Vercelli 2012.
Experte
Dr. Nicolas Maniu ist Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Museum Brandhorst in München. Sein Forschungsfeld ist die queere Kunstgeschichte mit Fokus auf Männlichkeitsbilder, Bildpolitik der Frühen Neuzeit, Geschlechtertheorie, Sexualitätsdiskurse und visuelle Repräsentationen. Er ist Autor des Buches Queere Männlichkeiten: Bilderwelten männlich-männlichen Begehrens und queerer Geschlechtlichkeit, Bielefeld 2023.
Credits
Autorin der Folge: Annika Hüther (annika.huether"AT"uni-hamburg.de)
Redaktion, wissenschaftliche Betreuung und Lektorat: Dr. Jana Graul
Sprecherinnen und Sprecher: Annika Hüther (Sprecherin), Dr. Nicolas Maniu (Experte), Joachim Weihe (Vasari deutsch), Stefano Zanobini (Vasari italienisch), Vincent Nicholas Ellmers (Hörspielelemente), Giuseppe Rossi (Definition Crusca)
Hörspielelemente: Miskatonic Theaterensemble
Schnitt und Sound: Vincent Ellmers
Musik: Tobias Hume (1569-1645), A Merry Meeting. Stefano Zanobini, Viola d’Amore. Mit freundlicher Genehmigung von NovAntiqua Records. Album verfügbar...
Ton: Travel with the strings, younoise, pixabay
Grafik: Darius Wakilzadeh
Folge 2
Eine Frage der Ehre: Der Selbstmord des Malers Rosso Fiorentino
Paris, 1540: Auf der Höhe seines Ruhmes nimmt sich der Maler Rosso Fiorentino das Leben. Suizid ist zu dieser Zeit aus Sicht der Kirche eine Todsünde und die Leichname von Selbstmördern werden geschändet. Doch für Rossos Seele wird wenige Tage nach seinem Tod eine heilige Messe in der Kathedrale Notre Dame abgehalten. Warum nimmt sich ein aus ärmlichen Verhältnissen stammender Maler das Leben, obwohl er sich als Hofkünstler des französischen Königs Franz I. künstlerischen Ruhm und finanziellen Erfolg erarbeitet hat? Und warum wird sein Selbstmord nicht als Todsünde geahndet?
Anhören:
Kurzbiographie des Künstlers
Rosso Fiorentino, eigentlich Giovanni Battista di Jacopo di Guasparre, geboren am 8. März 1495 in Florenz, war ein italienischer Maler. Sein Künstlername spielt auf Rossos rote Haarfarbe und seine Florentiner Herkunft an. In Florenz erfolgte auch seine Ausbildung bei Andrea del Sarto, der ebenfalls der Lehrmeister von Rossos Freund und späteren Biographen Giorgio Vasari war. Bis auf wenige Ausnahmen war Rosso bis 1523 in seiner Heimatstadt tätig, um ab 1524 in Rom die Werke Michelangelos und der Antike zu studieren.
Nach der Plünderung Roms durch die Truppen Karl V. im Jahr 1527, die Rosso dazu zwang, die Stadt zu verlassen, arbeitete er in Perugia, Sansepolcro, Città di Castello, Arezzo sowie Venedig und folgte schließlich der Einladung des französischen Königs Franz I. an dessen Hof in Fontainebleau. Dort wurde Rosso die Leitung sämtlicher Dekorationsarbeiten übertragen – eine Aufgabe, die ihm künstlerischen Ruhm, Einfluss und die privilegierte Stellung als Hofkünstler einbrachte. Als Hauptwerk gilt Rossos Ausstattung der Galerie Franz I. im Schloss Fontainebleau, die er zwischen 1531 und 1540 schuf. Am 14. November 1540 starb Rosso Fiorentino in Paris, mutmaßlich durch Suizid.
Links zu besprochenen Werken
Rosso Fiorentino: Studie einer männlichen Figur (Empedokles und/oder Der heilige Rochus), ca. 1539–1540, Rötel auf Papier, 25,1 × 14,8 cm, The J. Paul Getty Museum, Los Angeles, LINK
René Boyvin nach Rosso Fiorentino: Empedokles, ca. 1545–1563, Kupferstich, 26,5 x 16,5 cm, The Metropolitan Museum of Art, New York, LINK
Weiterführende Literatur
- Ciardi, Roberto Paolo, Alberto Mugnaini: Rosso Fiorentino: Catalogo completo dei dipinti, Florenz 1991.
- Cordellier, Dominique: „Rosso Fiorentino, l’homme vu par Giorgio Vasari“, in: Rosso Fiorentino. Ritorno in Francia. Retour en France, hrsg. v. Monica Bietti, Florenz/Paris 2014, S. 70-74.
- Kucher, Miriam: Selbst aus dem Leben gehen. Wertungen des Suizids im Wandel der Zeit. Ansätze aus den Bereichen Philosophie, Soziologie, Psychologie und Pädagogik, Diplomarbeit, Klagenfurt, 2013.
- Minois, Georges: History of Suicide: Voluntary Death in Western Culture, Baltimore 2001.
- Schrodi-Grimm, Renate: Die Selbstmörderin als Tugendheldin. Ein frühneuzeitliches Bildmotiv und seine Rezeptionsgeschichte, Dissertation, Georg-August-Universität Göttingen, 2009
- Vasari, Giorgio: Das Leben des Rosso Fiorentino, hrsg. v. Sabine Feser, Berlin 2004.
- Waldman, Louis Alexander: „The Origins and Family of Rosso Fiorentino“, in: The Burlington Magazine, 142 (Oktober 2000), S. 607-612.
- Wittkower, Margot und Rudolf: Künstler – Außenseiter der Gesellschaft, Stuttgart 1989, S. 149-165.
Quellen
- Guicciardini, Francesco: „Ob es lobenswert ist oder nicht, sich selbst umzubringen, um die Freiheit nicht zu verlieren oder das Vaterland nicht in Knechtschaft sinken zu sehen, und ob es ein Zeichen von Geistesgröße oder von Feigheit ist“, in: Welt der Renaissance, hrsg. v. Tobias Roth, Berlin 2020, S. 469-476.
- Vasari, Giorgio: Le vite dei più eccellenti pittori, scultori e architetti (1550/1568), hrsg. v. Rosanna Bettarini/Paola Barocchi, Florenz 1966-1997.
- Vasari, Giorgio: Das Leben des Rosso Fiorentino, hrsg. v. Sabine Feser, Berlin 2004.
Expertinnen und Experten
Prof. Dr. Dr. h.c. Horst Bredekamp ist emeritierter Professor der Humboldt-Universität zu Berlin. Seine Forschungsschwerpunkte liegen im Bereich Bildersturm, Skulptur der Romanik, Kunst der Renaissance und des Manierismus, Politische Ikonographie, Kunst und Technik sowie Neue Medien. Er ist Autor des für das Podcastthema einschlägigen Buches Der Künstler als Verbrecher. Ein Element der frühmodernen Rechts- und Staatstheorie, München 2008, das sich mit der künstlerischen Sonderstellung vor dem Gesetz in der Renaissance auseinandersetzt.
Dr. Tobias Roth ist Literaturwissenschaftler; er wurde mit einer Studie zur Lyrik und Philosophie der italienischen Renaissance promoviert. Er arbeitet als freier Autor, Lyriker, Herausgeber und Übersetzer. Als eines der schönsten Bücher des Jahres 2020 gilt sein gehaltvolles Lesebuch Die Welt der Renaissance, Berlin 2020, das auf beeindruckende Weise den Facettenreichtum der Epoche der italienischen Renaissance einfängt.
Credits
Autor: Darius Wakilzadeh, Kunstgeschichtliches Seminar der Universität Hamburg (darius.wakilzadeh@studium.uni-hamburg.de)
Redaktion, wissenschaftliche Betreuung und Lektorat: Dr. Jana Graul, Kunstgeschichtliches Seminar der Universität Hamburg
Sprecherinnen und Sprecher: Darius Wakilzadeh (Sprecher), Prof. Dr. Horst Bredekamp (Experte), Dr. Tobias Roth (Experte), Joachim H. Weihe (Vasari deutsch), Stefano Zanobini (Vasari italienisch)
Schnitt: Darius Wakilzadeh, Vincent Ellmers
Sound: Vincent Ellmers, Sven Remer
Musik: Tobias Hume (1569-1645), A Merry Meeting. Stefano Zanobini, Viola d’Amore. Mit freundlicher Genehmigung von NovAntiqua Records. Album verfügbar auf: https://www.novantiqua.net/prodotto/A-Question-an-Answer
Grafik: Darius Wakilzadeh
Folge 3
Leidenschaft als Laster – das Feuer der Bildhauerin Properzia de’ Rossi
Was geschah in der italienischen Renaissance, wenn eine talentierte Künstlerin gegen die moralischen Normen verstieß? Galt auch für sie, wie für viele ihrer männlichen Kollegen, die Regel der Ausnahme? Diese Episode beleuchtet das außergewöhnliche Leben und Wirken der Bildhauerin Properzia de’ Rossi, die in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts in Bologna lebte. Als einzige moderne Künstlerin wird sie in Giorgio Vasaris berühmter Vitensammlung mit einer eigenen Biographie gewürdigt, in der auch ihr vermeintliches Laster – ihre Leidenschaft – zur Sprache kommt. Archivdokumente geben Aufschluss über Properzia de’ Rossis unkonventionelle Lebensweise und ihre Konflikte mit dem Gesetz. Erfahrt, wie sie mit Mut und Leidenschaft ihren eigenen Weg verfolgte.
Kurzbiographie der Künstlerin
Die Bildhauerin Properzia de’ Rossi (ca. 1490-1530) stellt in mehrfacher Hinsicht eine Ausnahme dar. Nicht nur ist sie in ihrer Zeit die einzige bekannte Frau, die in der Marmorbearbeitung tätig war, sondern sie ist auch die einzige Künstlerin, die an einem prestigeträchtigen öffentlichen Auftrag beteiligt wurde. Geboren in Bologna, wo sie auch lebt und künstlerisch wirkt, gelingt es ihr aufgrund ihrer bemerkenswerten Fähigkeiten, sich in einer von Männern dominierten Kunstwelt zu etablieren. Ihren wichtigsten Auftrag erhält sie in der ersten Hälfte der 1520er Jahre: sie wird von der Bauhütte der Basilika San Petronio in Bologna engagiert, an der Gestaltung der Kirchenfassade mitzuwirken. Ihr heute bekanntestes Werk ist das in diesem Kontext entstandene Relief Joseph und Potiphars Weib. Das beigefügte ‘Porträt’ aus Giorgio Vasaris Vita zeigt die Künstlerin zwar wenig plausibel nonnenhaft verhüllt, trägt dafür aber ihrem künstlerischen Schaffen Rechnung, denn, wie erst der zweite Blick verrät, ist Properzia de’ Rossis Bildnis von Vasari als Marmorbüste angelegt.
Link zum besprochenen Werk
Properzia Rossi: Joseph und Potiphars Weib, 1526-1527, Marmorrelief 63 x 82 cm, Museo di Basilika San Petronio, Bologna, LINK
Weiterführende Literatur
- Cohen, Elizabeth S.: „Honor and Gender in the Streets of Early Modern Rome“, in: The Journal of Interdisciplinary History, 22, 4 (Spring 1992), S. 597-625.
- Feser, Sabine: “Einleitung”, in: Giorgio Vasari, Das Leben der Bildhauer des Cinquecento, neu übers. u. hrsg. v. ders. u. Victoria Lorini, hrsg., eingel. u. komm. v. ders., Christina Irlenbusch u. Katja Lemelsen, Berlin 2007, S. 121-124.
- Feser, Sabine: “Anmerkungen zum Leben der Properzia de’ Rossi”, in: Giorgio Vasari, Das Leben der Bildhauer des Cinquecento, neu übers. u. hrsg. v. ders. u. Victoria Lorini, hrsg., eingel. u. komm. v. ders., Christina Irlenbusch u. Katja Lemelsen, Berlin 2007, S. 291-307.
- Jacobs, Fredrika H: „The construction of a life: Madonna Properzia de‘ Rossi ‚Scultrice‘ Bolognese“, in: Word & Image, 9 (2012), S.122-132.
- Wenderholm, Iris: „Flammen der Liebe, in Stein gebannt. Zur Sublimierung von Leidenschaften bei Künstlerinnen der Frühen Neuzeit“, in: Jörn Steigerwald und Valeska von Rosen (Hrsg.), Amor e sacro e profano: Modelle und Modellierungen der Liebe in Literatur und Malerei der italienischen Renaissance, Wiesbaden 2012, S. 259-279.
Quellen
- Vasari, Giorgio: Le vite dei più eccellenti pittori, scultori e architetti (1550/1568), hrsg. v. Rosanna Bettarini/Paola Barocchi, Florenz 1966-1997.
- Vasari, Giorgio: „Das Leben der Bildhauerin Properzia de’ Rossi“, in: Giorgio Vasari. Das Leben der Bildhauer des Cinquecento. Neu übersetzt und kommentiert, hrsg. v. Sabine Feser; Matteo Burioni; Katja Lemelsen, Berlin 2007, S. 125-130.
Expertinnen
Prof. Dr. Iris Wenderholm ist Professorin am Kunstgeschichtlichen Seminar der Universität Hamburg. Ihre Forschungsschwerpunkte liegen in der Kunst und Wissenschaft der Frühen Neuzeit, Bildtheorien, Körperbildern und der Genderforschung, insbesondere im Kontext der europäischen Kunstgeschichte. Sie beschäftigt sich mit Fragen der Materialität, Alterität und der Beziehung zwischen Kunst und Natur. Sie ist Autorin eines 2012 erschienenen, für das Podcastthema einschlägigen Aufsatzes zur Sublimierung von Leidenschaften bei Künstlerinnen der Frühen Neuzeit.
Dr. Jana Graul lehrt am Kunstgeschichtlichen Seminar der Universität Hamburg, wo sie die Professur von Prof. Dr. Frank Fehrenbach vertritt. Ihre Forschungsschwerpunkte liegen im Bereich der Kunst der Frühen Neuzeit, mit Fokus auf Italien und Europa, Europadiskurs und Kunstschaffen, sozialen, ästhetischen und theoretischen Fragen zu Moral und Kunst, Neidkonzeptionen, künstlerischen Selbstinszenierungsstrategien und Identitätskonstruktion, Affekt- und Streitkulturen sowie Medizin und Kunst. Sie ist Autorin des Buches: Neid. Kunst, Moral und Kreativität in der Frühen Neuzeit, München 2022.
Credits
Autorin der Folge: Joana Laura Noack (joana.laura.noack@studium.uni-hamburg.de)
Redaktion, wissenschaftliche Betreuung und Lektorat: Dr. Jana Graul
Sprechende: Joana Laura Noack (Sprecherin), Dr. Jana Graul und Prof. Dr. Iris Wenderholm (Expertinnen), Stefano Zanobini (Vasari italienisch)
Schnitt und Sound: Joana Laura Noack und Dominik Sydney Noack (DSN Audioproduktion)
Musik Intro/ Outro: Tobias Hume (1569-1645), A Merry Meeting. Stefano Zanobini, Viola d’Amore. Mit freundlicher Genehmigung von NovAntiqua Records. Album verfügbar auf
Grafik: Darius Wakilzadeh
Folge 4
Wenn Frevelhaftigkeit Talent und Tugend begräbt: Andrea del Castagnos Neid auf Domenico Veneziano
Ein heimtückischer Mord an einem Maler, begangen auf offener Straße an einem Sommerabend in Florenz. Ein Täter, der sein Opfer grausam erschlägt; ein Opfer, das in den Armen eines Kollegen und (vermeintlichen) Freundes verstirbt. Tradiert wird diese Geschichte von dem Künstlerbiographen Giorgio Vasari in der Doppelvita der Maler Domenico Veneziano und Andrea del Castagno, die rund ein Jahrhundert vor ihm lebten. Doch was hat es mit der spektakulären Morderzählung auf sich? Was genau ist passiert? Wer sind Opfer und Täter? Und was hat all das mit der Kunst zu tun?
In dieser Folge steht mit dem Neid ein in der Renaissance als besonders verabscheuenswürdig aufgefasstes Laster im Mittelpunkt. Aber auch das seinerzeit hochgeschätzte Ideal der Freundschaft und künstlerische Qualitäten, allen voran die Fähigkeit der Täuschung, spielen eine wichtige Rolle. Seid vorgewarnt: hier ist nichts so, wie es auf den ersten Blick scheint!
Anhören:
Kurzbiographie der Künstler
Domenico Veneziano, eigentlich Domenico di Bartolomeo, ist um 1410 geboren und verstirbt im Alter von 54 Jahren. In der Florentiner Kunstszene nimmt Veneziano Mitte des 15. Jahrhunderts eine zentrale Stellung ein. Dennoch ist nicht viel über ihn bekannt. Beispielsweise ist unklar, wo er geboren wird und wo er in die Lehre geht. Da Veneziano seine Werke mit dem Zusatz “de Venetis“ - „aus Venedig” - signiert, wird angenommen, dass er aus der Lagunenstadt stammt. Seine Ausbildung dürfte aber zumindest in Teilen bereits in Florenz erfolgt sein. Sein bekanntestes heute überliefertes Gemälde ist ein Altarbild, das sich in den Uffizien in Florenz befindet und zu den Höhepunkten dieser Bildgattung zählt. Gezeigt wird die thronende Jungfrau Maria mit dem Kind im Zwiegespräch mit Heiligen, eine frühe Form der sogenannten “Sacra conversazione”, einer „Heiligen Unterhaltung“ (vgl. Link unten).
Andrea del Castagno erblickt 1419 in Castagno, einem kleinen toskanischen Dörfchen, das Licht der Welt und verstirbt mit nur 38 Jahren in Florenz an der Pest. Auch über seine Ausbildung ist nichts Genaueres bekannt. Im Jahr 1440 wird er von der Florentiner Stadtregierung damit beauftragt, Schandbilder von den entwichenen Rebellen der Anghiari-Schlacht auszuführen. Diese Schandbilder bestrafen die Dargestellten in Abwesenheit per Bild, indem sie sie erhängt zeigen. Der Auftrag bringt Castagno den Spitznamen „Andreino degl’Impiccati“ („Andreas-chen der Erhängten“) ein, der noch nach seinem Tod kursiert. Es folgen weitere Gemälde und großformatige Fresken für Kirchen und Klöster, darunter auch das monumentale gemalte Grabmonument des Niccolò Torrentino im Florentiner Dom. Castagnos Bilder zählen zu den Hauptwerken der Florentiner Malerei des 15. Jahrhunderts.
Links zu Künstler und Werk
Domenico Veneziano: Madonna mit Kind, um 1445, Tempera auf Holz, 209 x 216 cm, Uffizien, Florenz, LINK
Andrea del Castagno: Grabmonument des Niccolò Tolentino, 1456, Fresko, 833 x 522 cm, Kathedrale Santa Maria del Fiore, Florenz, LINK
Weiterführende Literatur
- Dunlop, Anne: Andrea del Castagno and the Limits of Painting, London 2015 (Renovatio artium 1).
- Graul, Jana: „Einleitung zum Leben des Andrea del Castagno“, in: Vasari, Giorgio: Das Leben des Filippo Lippi, des Pesello und Pesellino, des Andrea del Castagno und Domenico Veneziano und des Fra Angelico, hrsg. v. Jana Graul / Heiko Damm, Berlin 2011, S. 45-51.
- Graul, Jana: „Tanto lontano da ogni virtù“ Zu Konkurrenz, Neid und falscher Freundschaft in Vasaris Vita des Andrea del Castagno und Domenico Veneziano”, Kunsttexte (Nr. 1, 2012), https://journals.ub.uni-heidelberg.de/index.php/kunsttexte/article/view/88090 (abgerufen am 16.04.2024).
- Graul, Jana: Neid. Kunst, Moral und Kreativität in der Frühen Neuzeit, München 2022.
- Nethersole, Scott: Art and violence in early Renaissance Florence, New Haven/ London 2018, S. 209-222.
- Rubin, Pat: Giorgio Vasari. Art and History, New Haven/London 1995.
- Vasari, Giorgio: Das Leben des Filippo Lippi, des Pesello und Pesellino, des Andrea del Castagno und Domenico Veneziano und des Fra Angelico, hrsg. v. Jana Graul / Heiko Damm, Berlin 2011.
Quellen
- Vasari, Giorgio: Le vite dei più eccellenti pittori, scultori e architetti (1550/1568), hrsg. v. Rosanna Bettarini/Paola Barocchi, Florenz 1966-1997.
- Vasari, Giorgio: Das Leben des Filippo Lippi, des Pesello und Pesellino, des Andrea del Castagno und Domenico Veneziano und des Fra Angelico, hrsg. v. Jana Graul / Heiko Damm, Berlin 2011.
Expertin
Dr. Jana Graul ist Kunsthistorikerin und lehrt an der Universität Hamburg, wo sie die Professur von Prof. Dr. Frank Fehrenbach vertritt. Ihre Forschungsschwerpunkte liegen im Bereich der Kunst der Frühen Neuzeit, mit Fokus auf Italien und Europa, Europadiskurs und Kunstschaffen, sozialen, ästhetischen und theoretischen Fragen zu Moral und Kunst, Neidkonzeptionen, künstlerischen Selbstinszenierungsstrategien und Identitätskonstruktion, Affekt- und Streitkulturen sowie Medizin und Kunst. Sie ist Autorin des Buches: Neid. Kunst, Moral und Kreativität in der Frühen Neuzeit, München 2022 und hat sich dort wie auch an anderer Stelle eingehend mit der Vasaris Erzählung von Castagno und Veneziano befasst.
Credits
Autor: Tobias Techen, Kunstgeschichtliches Seminar der Universität Hamburg (tobias.techen@uni-hamburg.de)
Redaktion, wissenschaftliche Betreuung und Lektorat: Dr. Jana Graul, Kunstgeschichtliches Seminar der Universität Hamburg
Sprechende: Tobias Techen (Sprecher), Dr. Jana Graul (Expertin)
Hörspielelemente: Miskatonic Theater Ensemble
Schnitt: Vincent Nicholas Ellmers, Tobias Techen
Sound: Vincent Nicholas Ellmers
Musik Intro/ Outro: Tobias Hume (1569-1645), A Merry Meeting. Stefano Zanobini, Viola d’Amore. Mit freundlicher Genehmigung von NovAntiqua Records. Album verfügbar hier.
Grafik: Darius Wakilzadeh
Folge 5
Benvenuto Cellinis furor oder was Wut und Gewalt mit Kunst zu tun haben
Unser heutiges Bild des berühmten italienischen Bildhauers Benvenuto Cellini aus der Mitte des 16. Jahrhunderts ist von widerstreitenden Aspekten geprägt. Auf der einen Seite steht ein Künstler, der mehrere Menschen tötet und auch noch in seiner Autobiographie damit prahlt; auf der anderen einer, der großartige Kunstwerke schafft. Im Mittelpunkt dieser Folge steht das aggressive Verhalten des Bildhauers und die moralischen Fragen, die sich damit verbinden.
Wie kann es sein, dass er so offen über seine Gewaltakte spricht? Muss er sich für seine Straftaten verantworten? Nicht nur seine ausgeprägte Neigung, Probleme mit Gewalt zu lösen, soll dabei im Fokus stehen. Es geht auch um die Rahmenbedingungen, die sein Verhalten befeuern und um die Strategien, die er findet, um seine Brutalität zu rechtfertigen. Und schließlich kreist die Folge darum, wie es Cellini nach eigener Darstellung gelingt, seine zerstörerischen Neigungen in Zaum zu halten und dadurch in Kunst zu überführen.
Anhören:
Kurzbiographie des Künstlers
Benvenuto Cellini wird im Jahr 1500 in Florenz geboren und verstirbt ebenda 1571 nach einem Leben voller Höhen und Tiefen. Er arbeitet für bedeutende Auftraggeber und wird als Künstler hochgeschätzt, steht aber auch mehrfach vor Gericht und verbüßt sogar Haftstrafen. Nach einer Ausbildung in seiner Heimatstadt, geht Cellini auf Wanderschaft und tritt zunächst als Musiker in den päpstlichen Dienst, bevor er in Rom eine eigene Künstlerwerkstatt eröffnet; später ernennt Clemens VII. ihn zum Stempelmeister der päpstlichen Münzprägeanstalt.
Im Jahr 1536 folgt Cellini der Einladung von König Franz I. an den französischen Hof, wo er als Goldschmied tätig ist, bis ihn der Florentiner Herzog Cosimo I. 1545 mit der Aussicht auf eine großformatige Bronzeskulptur abwirbt – den Perseus. Dieser soll sein bedeutendstes Werk werden. Cellinis im Anschluss im Hausarrest verfasste Autobiographie, ein fesselnder Text, ist ein wichtiges Zeugnis künstlerischen Selbstverständnisses im Italien des 16. Jahrhunderts. Was allerdings die Frage nach seinem Aussehen anbelangt, so sind wir auf Mutmaßungen angewiesen; hier ist eine spätere Darstellung aus dem Jahr 1750 angefügt.
Links zu Künstler und Werk
Benvenuto Cellini (1500 – 1571) italienischer Goldschmied und Bildhauer, LINK
Benvenuto Cellini, Perseus und Medusa, 1545-1554, Bronze, Höhe (ohne Sockel) 320 cm, Florenz, Piazza della Signoria, Loggia dei Lanzi, LINK
Weiterführende Literatur
- Beyer, Andreas: Cellini. Ein Leben im Furor, Berlin 2024.
- Bredekamp, Horst: „Cellinis Kunst des perfekten Verbrechens. Drei Fälle“, in: Benvenuto Cellini. Kunst und Kunsttheorie im 16. Jahrhundert, hrsg. von Alessandro Nova/Anna Schreurs, Köln 2003, S. 337-348.
- Bredekamp, Horst: Der Künstler als Verbrecher. Ein Element der frühmodernen Rechts- und Staatstheorie, München 2008.
- Graul, Jana: Neid. Kunst, Moral und Kreativität in der Frühen Neuzeit, München 2022.
- Graul, Jana: „Kranke Künstler. Das kreative Potential körperlicher Leiden in der Frühen Neuzeit“, in: Kunst und Gebrechen, hrsg. von Hildegard Fraueneder/ Nora Grundtner, Manfred Kern, Wien 2024, S. 75-135, bes. S. 105-112.
- Kantorowicz, Ernst H.: „The Sovereignty of the Artist. A Note of Legal Maxims and Renaissance Theories of Art“, in: De Artibus Opuscula XL. Essays in Honor of Erwin Panofsky, hrsg. von Millard Meiss, New York 1961, S. 267-279.
- Magnago Lampugnani, Anna: Furor. Vorstellungen künstlerischer Eingebung in der Frühen Neuzeit, Müchen 2020.
- Plackinger, Andreas: Violenza. Gewalt als Denkfigur im michelangelesken Kunstdiskurs, Berlin/Boston 2016.
Quellen
- Cellini, Benvenuto: La Vita [ca. 1566], hrsg. von Guido Davico Bonino, Turin 1973.
- Cellini, Benvenuto: Mein Leben. Die Autobiographie eines Künstlers aus der Renaissance, hrsg. u. übers. von Jacques Laager, Zürich 2000.
Experte
Prof. Dr. Dr. h.c. Horst Bredekamp ist emeritierter Professor der Humboldt-Universität zu Berlin. Seine Forschungsschwerpunkte liegen im Bereich Bildersturm, Skulptur der Romanik, Kunst der Renaissance und des Manierismus, Politische Ikonographie, Kunst und Technik sowie Neue Medien. Er ist Autor des für das Podcastthema einschlägigen Buches Der Künstler als Verbrecher. Ein Element der frühmodernen Rechts- und Staatstheorie, München 2008, das sich mit der künstlerischen Sonderstellung vor dem Gesetz in der Renaissance auseinandersetzt.
Credits
Autor: Joachim H. Weihe (joachim.weihe@studium.uni-hamburg.de)
Redaktion, wissenschaftliche Betreuung und Lektorat: Dr. Jana Graul, Kunstgeschichtliches Seminar der Universität Hamburg
Sprechende: Joachim H. Weihe (Sprecher); Prof. Dr. Horst Bredekamp (Experte); Emanuele Berkenhoff (Cellini italienisch); Vincent Ellmers (Cellini und Papst Paul III. deutsch)
Schnitt: Joachim H. Weihe
Sound: Paul Voigt
Grafik: Darius Wakilzadeh
Link zum Transkript der Folge
Folge 6
Guido Reni - der Malerfürst und das Glücksspiel
Der Künstler Guido Reni ist einer der erfolgreichsten Maler des 17. Jahrhunderts. Nicht nur in Italien, sondern auch beim europäischen Adel sind seine Bilder sehr begehrt. Er arbeitet am päpstlichen Hof und stilisiert sich zum ‚göttlicher‘ Künstler und Malerfürst. Aber Reni hat auch ein Laster. Er ist dem Glücksspiel verfallen. Seine Spielsucht begleitet ihn weite Teile seines Lebens und ist letztendlich sein sozialer Ruin. Ein göttlicher Künstler, der zockt? Wie passt das zusammen?
Wie Ihr sehen werdet, vereint Reni noch eine ganze Menge weiterer Widersprüche auf sich. So ist er einerseits ein äußerst erfolgreicher frühkapitalistischer Unternehmer, der es schafft, seine Kundschaft davon zu überzeugen, dass seine Werke jeden Preis wert sind. Doch gibt er andererseits sein Geld sofort mit vollen Händen wieder aus, indem er es entweder großzügig spendet oder eben verspielt. Auf Ausbeutung reagiert er allergisch und ist im selben Moment sehr fromm. Die Folge ergründet, woher wir heute überhaupt von Renis Laster wissen, wie seine Auftraggebenden mit diesem umgehen und inwieweit sich die Spielsucht auf das Schaffen des Malers auswirkt.
Anhören:
Kurzbiografie des Künstlers
Guido Reni wurde 1575 in Bologna geboren und starb 1642 ebenda. Er lernte in seiner Heimatstadt zunächst bei Denis Calvaert, bevor er sich der Akademie der Carracci anschloss. Im Jahr 1600 ging er nach Rom, wo er schnell Kardinäle als Auftraggeber gewinnen konnte. Seine wichtigsten Gönner waren Kardinal Scipione Borghese und dessen Onkel, Papst Paul V., von denen er ab 1608 prestigeträchtige Kommissionen erhielt, u.a. im Vatikan- und im Quirinalspalast sowie in der Papstbasilika Santa Maria Maggiore.
Das letztgenannte Projekt von 1610 unterbrach er allerdings im Streit mit dem Schatzmeister der Kirche und kehrte eine Zeitlang nicht nur Rom, sondern auch der Malerei den Rücken zu, stieg dann aber wieder ein und vollendete die zuvor unterbrochene Kapellendekoration. Wiederum für Scipione Borghese führte er 1614 in Rom ein Deckenfresko mit dem mythologischen Sujet der Aurora aus, das heute zu seinen bedeutendsten Werken zählt.
Im Anschluss ging Reni zurück nach Bologna, wo er abgesehen von kürzeren Aufenthalten in Neapel und Rom bis zu seinem Lebensende blieb und sich eine große, sehr erfolgreiche Werkstatt aufbaute, die Aufträge aus ganz Italien und Europa ausführte. Obwohl seine Werke reißenden Absatz fanden, starb er 1642 hochverschuldet.
Links zu Künstler und Werk
Kopie nach Guido Reni, Selbstbildnis, um 1635, Florenz, Galleria degli Uffizi LINK
Guido Reni, Aurora, 1612-14, Fresko, 280 x 700 cm, Rom, Palazzo Pallavicini Rospigliosi, Casino dell‘Aurora LINK
Weiterführende Literatur
- Ebert-Schifferer, Sybille: „Der Künstler, ein Fürst. Guido Renis Karriere zwischen Selbststilisierung und Spielsucht“, in: Guido Reni. Der Göttliche, Ausst.-Kat., Städel Museum Frankfurt am Main, Frankfurt 2022, S. 40-51.
- Fehrenbach, Frank: Quasi vivo. Lebendigkeit in der italienischen Kunst der Frühen Neuzeit, Berlin-Boston 2021.
- Guido Reni und Europa. Ruhm und Nachruhm, hrsg. v. Sybille Ebert-Schifferer u. Andrea Emiliani, Ausst.-Kat., Schirn-Kunsthalle, Frankfurt 1988.
- Guido Reni. Der Göttliche, hrsg. v. Bastian Eclercy, Ausst.-Kat., Städel-Museum Frankfurt, Berlin 2022.
- Pericolo, Lorenzo: „Beyond Perfection. Guido Reni abd Malvasia’s Fourth Age of Painting“, in: Malvasia 2019, Bd. 2, S. 1-132.
- Spear, Ricard E.: The „Divine“ Guido. Religion, Sex, Money and Art in the World of Guido Reni, New Haven/ London 1997.
Quellen
- Bellori, Giovan Pietro: Le vite de‘ pittori, scultori e architetti moderni, hrsg. v. Evelina Borea, 2Bde., Turin 2009 (1. Aufl. 1976).
- Malvasia, Carlo Cesare: Felsina pittrice. Vite de‘ pittori bolognesi, 2 Bde., Bologna 1678.
- Malvasia, Carlo Cesare: Felsina Pittrice. Lives of the Bolognese, Bd. 9: The Life of Guido Reni, hrsg. v. Elisabeth Cropper u. Lorenzo Pericolo, 2 Bde., London/Turnhout 2019.
Expertinnen und Experten
Prof. Dr. Sibylle Ebert-Schifferer ist Kunsthistorikerin. Bis zu ihrer Emeritierung 2018 war sie Direktorin der Bibliotheca Hertziana-Max-Planck-Institut für Kunstgeschichte in Rom; zuvor u.a. Generaldirektorin der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden. Einer ihrer Forschungsschwerpunkte liegt im Bereich der italienischen Malerei des 16. und 17. Jahrhunderts und hier speziell auf der Malerei in Rom im Zeitraum 1580-1630. In diesem Kontext hat sie sich eingehend mit Guido Reni auseinandergesetzt, darunter im Katalog der von ihr mitkuratierten Ausstellung Guido Reni und Europa. Ruhm und Nachruhm, die 1988-89 in der Schirn-Kunsthalle in Frankfurt zu sehen war. Für die Fragestellung der Podcastfolge ist ihr jüngerer Essay zu Guido Renis Karriere zwischen Selbststilisierung und Spielsucht von 2022 von besonderer Relevanz.
Prof. Dr. Frank Fehrenbach ist Professor für Kunstgeschichte der italienischen Renaissance und des Barock am Kunstgeschichtlichen Seminar der Universität Hamburg. Seit 2019 ist er Co-Sprecher der DGF-Kollegforschungsgruppe Imaginarien der Kraft. Seine Forschungsschwerpunkte liegen im Bereich der Beziehungen zwischen Kunst, Naturphilosophie und Naturwissenschaften. Aktuell erforscht er die „Kraft“ als ästhetische Kategorie und arbeitet zu Leonardo da Vinci. In seinem Buch Quasi vivo. Lebendigkeit in der italienischen Kunst der Frühen Neuzeit, Berlin-Boston 2021 hat er sich mit dem Topos der Lebendigkeit im Kunstdiskurs auseinandergesetzt.
Credits
Autorin: Annett Beyer, Kunstgeschichtliches Seminar der Universität Hamburg (annett.beyer@studium.uni-hamburg.de)
Redaktion, wissenschaftliche Betreuung und Lektorat: Dr. Jana Graul, Kunstgeschichtliches Seminar der Universität Hamburg
Sprechende: Annett Beyer (Sprecherin), Prof. Dr. Sibylle Ebert-Schifferer (Expertin); Prof. Dr. Frank Fehrenbach (Experte); Martin Beyer (Malvasia deutsch); Vincent Nicholas Ellmers (Urban VIII. deutsch); Alessandro Volpe (Malvasia italienisch u. Urban VIII.)
Schnitt und Sound: Vincent Nicholas Ellmers, Paul Voigt
Musik Intro/ Outro: Tobias Hume (1569-1645), A Merry Meeting. Stefano Zanobini, Viola d’Amore. Mit freundlicher Genehmigung von NovAntiqua Records. Album verfügbar..
Grafik: Darius Wakilzadeh
Folge 7
Suizid im Tiber? Pietro Testa und das Geheimnis seines Todes
Am 1. März 1650 wird der italienische Maler und Druckgrafiker Pietro Testa tot im Tiber aufgefunden. Schnell kursiert das Gerücht, der Künstler habe sich vorsätzlich in den Fluss gestürzt, also sich das Leben genommen. Angesichts materieller Sorgen und mangelnder Anerkennung scheint diese Möglichkeit nicht gänzlich aus der Luft gegriffen. Jedoch betrachten andere, darunter auch Freunde Testas, seinen Tod als tragisches Unglück. Freitod oder Unfall? Welche Umstände haben wirklich zum mysteriösen Tod des Künstlers im Tiber geführt? Und war es im 17. Jahrhunderts überhaupt ‚erlaubt‘, sich selbst zu töten?
Die Folge geht diesen Fragen auf den Grund und verfolgt diverse Spuren zu Testas tragischem Ende. Im Mittelpunkt stehen dabei drei Biographien des Künstlers, die sein Ableben – soviel sei bereits verraten – jeweils anders darstellen. Aber warum ist das so? Und was lässt sich daraus ableiten, über das Ereignis selbst und über die Moralvorstellungen von Testas Zeitgenossen? Und: gilt die Regel der Ausnahme eigentlich auch für einen Künstler ohne mächtige Förderer?
Anhören:
Kurzbiographie des Künstlers
Der italienische Zeichner, Maler, Druckgrafiker und Schriftsteller Pietro Testa wird 1612 im toskanischen Lucca geboren. Um 1628 verlässt er seine Heimatstadt, um in Rom Malerei zu studieren. Hier absolviert er eine Ausbildung beim namhaften Maler Domenichino und zeichnet in dieser Zeit mit großem Elan und Talent die antiken Relikte der Stadt.
Der Weggang seines Meisters Domenichino aus Rom zwingt Testa schnell auf eigene Beine. Er nimmt Aufträge für Ölgemälde sowie Fresken in Rom und seiner Heimatstadt an, jedoch plagen ihn Geldsorgen. So verdient er sich v.a. mit Zeichnungen und Radierungen seinen Lebensunterhalt. Testa gilt als einer der herausragendsten und innovativsten Grafiker seiner Zeit. Er fertigt komplexe allegorische und mythologische Werke an, die von seiner intensiven Auseinandersetzung mit antiker Kunst, Literatur und Philosophie zeugen. Zudem stellt er kunsttheoretische Überlegungen an, die er in zahlreichen Notizen festhält. Eine geplante Abhandlung konnte er aufgrund seines frühen Ablebens jedoch nicht abschließen. Testa wird im Jahre 1650 tot im Tiber aufgefunden.
Links zu besprochenen Werken
Pietro Testa: Selbstporträt, um 1645, Radierung, Papier, 22,4 x 16,6 cm, Graphische Sammlung Albertina, Wien. LINK
Pietro Testa: Tod des Cato, um 1648, Kaltnadelradierung, Papier, 27,6 x 41,1 cm, British Museum London LINK
Weiterführende Literatur
- Albl, Stefan: Pietro Testa. Maler in Rom und Lucca (1612-1650), Wien u.a. 2021.
- Alb, Stefan: „Affectus Exprimit. Die Rolle der Affekte im Schaffen von Pietro Testa“, in: Ars – Visus – Affectus. Visuelle Kulturen des Affektiven in der Frühen Neuzeit, hrsg. v. Isabella Augart/ Anna Pawlak/ Lars Zieke Berlin/ Bosten 2016, S. 233-251.
- Buhr, Heiko: Sprich, soll denn die Natur der Tugend Eintrag tun? Studien zum Freitod im 17. und 18. Jahrhundert, Würzburg 1998.
- Cropper, Elizabeth: The Ideal of Painting. Pietro Testa's Düsseldorf Notebook, Princeton 1984.
- Minois, Georges: Geschichte des Selbstmords. Aus dem Franz. von Eva Moldenhauer, Düsseldorf/ Zürich, 1996.
- Kucher, Mirjam: Selbst aus dem Leben gehen. Wertungen des Suizids im Wandel der Zeit. Ansätze aus den Bereichen Philosophie, Soziologie, Psychologie und Pädagogik, Klagenfurt 2013.
- Pietro Testa. 1612-1650. Prints and Drawings, hrsg. v. Elizabeth Cropper, Ausst.-Kat. Philadelphia Museum of Art, Philadelphia 1988.
Quellen
- Baldinucci, Filippo: Notizie de' professori del disegno da Cimabue in qua. Opera di Filippo Baldinucci. Fiorentino. Accademico della Crusca. Con Note ed Aggiunte, Milano 1812 (= Opere di Filippo Baldinucci, Bd. 13).
- Passeri Giovanni Battista: Die Künstlerbiographien von Giovanni Passeri. Nach den Handschriften des Autors hrsg. u. m. Anm. versehen v. Jacob Hess, Leipzig 1934.
- Sandrart, Joachim von: Teutsche Academie der Bau- Bild- und Mahlerey-Künste, hrsg. v. Thomas Kirchner, Alessandro Nova, Carsten Blüm, Anna Schreurs, Torsten Wübbena, 2008-2012, in: Sandrart.net URL https://www.sandrart.net/de/ (abgerufen am 01.09.2025).
Experte
Mag. Dr. Stefan Albl ist Sammlungskurator für die Frühe Neuzeit an der Alten Galerie im Universalmuseum Joanneum in Graz. Seine Forschungsschwerpunkte liegen im Bereich der italienischen Malerei und Zeichnung des 17. Jahrhundert und der Wechselwirkungen von frühneuzeitlicher Kunst und Wissenschaft sowie Kunsttheorie und Philosophie. Er ist ein eingehender Kenner Pietro Testas, zu dem er die Monographie Pietro Testa. Maler in Rom und Lucca (1612-1650) von 2021 sowie zahlreiche Aufsätze verfasst hat.
Credits
Autorin der Folge: Katrin Witt, Kunstgeschichtliches Seminar der Universität Hamburg
Redaktion, wissenschaftliche Betreuung und Lektorat: Dr. Jana Graul, Kunstgeschichtliches Seminar der Universität Hamburg
Sprechende: Katrin Witt (Sprecherin), Mag. Dr. Stefan Albl (Experte), Andrea Musco (Filippo Baldinucci italienisch), Roberto Venturini (Giovanni Battista Passeri italienisch), Nicholas Vincent Elmers (Joachim von Sandrart, Filippo Baldinucci deutsch, Giovanni Battista Passeri deutsch)
Schnitt: Katrin Witt
Soundelemente und Musik: freesound.org
Grafik: Darius Wakilzadeh
Musik Intro: Tobias Hume (1569-1645), A Merry Meeting. Stefano Zanobini, Viola d’Amore. Mit freundlicher Genehmigung von NovAntiqua Records.
Folge 8
Im Rausch der Kunst: die Bentvueghels zwischen Trunksucht und Inspiration
Rom, 1620: In den Tavernen der Stadt versammeln sich junge Niederländer, um in einer berühmt-berüchtigten Künstlergemeinschaft Aufnahme zu finden – den Bentvueghels. Deren ausgelassene Initiationsfeiern, „Bent-Taufen“ genannt, dauern oft mehr als vierundzwanzig Stunden, in denen viel Alkohol fließt und freudvoll, teils im Exzess und mit derbem Humor, das Leben und die Kunst gefeiert werden, u.a. durch die Inszenierung lebendiger Kunstwerke. Einige Zeitgenossen sind vom Verhalten der Fremden empört, die kirchliche Obrigkeit misstraut ihnen, und doch zieht die Bruderschaft über Jahrzehnte hunderte Maler, Bildhauer und Dichter an. Bei ihren Taufen verhöhnen sie auch katholische Zeremonien – ein Affront gegen die Kirche? Und was hat es mit dem Dauerrausch dieser Künstler auf sich? Bloß exzessive Entgleisung in der Fremde, oder doch tieferes künstlerisches Programm?
Anhören:
Kurzbiographie
Die Schildersbent (dt. “Malergruppe”) ist eine lose organisierte, freie Gemeinschaft hauptsächlich niederländischer und teils auch deutscher Künstler, die in der Zeit von 1620 bis 1720 in Rom aktiv war und sich selbst Bentvueghels (dt.: “Bande von freien Vögeln”) nannte. Ihre Mitglieder kommen zum Studium der antiken und modernen Kunst nach Rom und sind in der Regel zwischen 20 und 24 Jahre alt. Für viele unter ihnen ist die Künstlervereinigung die erste Anlaufstelle in der Ewigen Stadt – eine Art Ersatzfamilie in der Fremde und zugleich Netzwerk, Ort für Austausch und gegenseitige Unterstützung. Die unkonventionellen Werke der Mitglieder der Gruppierung sind schon bald nach ihrer Gründung in ganz Europa bekannt, was viele weitere reisende Künstler anzieht. In ihren besten Zeiten zählen die Bentvueghels um die fünfhundert Mitglieder, darunter später berühmt gewordene Namen wie Arnold Houbraken, Pieter van Laer, Samuel van Hoogstraten und der deutsche Maler Joachim von Sandrart.
Ein anschauliches Beispiel dafür, wie man sich die Bildschöpfungen der Gruppe vorstellen kann, liefert eine Zeichnung des holländischen Malers Pieter van Laer, die ausschnitthaft im Folgencover zu sehen ist. Sie zeigt eine Gruppe von Bentvuegels in einer Taverne: während einige von ihnen zu streiten scheinen, ist die Mehrzahl beim ausgelassenen Trinken, Rauchen, Feiern und Spielen dargestellt. Ein Maler wendet sich links der mit Zeichnungen überzogenen Tavernenwand zu, wohl in der Absicht, sich seinerseits zu verewigen. Indes prangt auf der rechten Seite bedrohlich ein Bild des Teufels, der sich einem Skelett zuwendet, das wiederum ein Stundenglas, Symbol der Vergänglichkeit, in Richtung der Betrachtenden hält.
Links zu besprochenen Werken
Pieter van Laer, Bentveughels in einer Taverne, o.D., Feder und Pinsel in Braun und Grau mit schwarzem Stift auf Papier, 20,3 x 25,8 cm, Staatliche Museen zu Berlin, Kupferstichkabinett, KdZ 5239 LINKCredit: Staatliche Museen zu Berlin, Kupferstichkabinett/ Jörg P. A. Anders Public Domain Mark 1.0
Abb. 1: Jan Asselijn, Im Freien arbeitende Künstler. Die Bent Vueghels, 1620, Feder in Grau, schwarze und rotbraune Kreide auf Papier, 18,7 x 23,7 cm, Staatliche Museen zu Berlin, Kupferstichkabinett, KdZ 144 LINK, Credit: Staatliche Museen zu Berlin, Kupferstichkabinett / Jörg P. Anders Public Domain Mark 1.0
Abb. 2: Matthijs Pool (?), nach Domenicus van Wijnen, Initiationsfeier der Schildersbent in Rom ,zwischen 1690 - 1710, Radierung, 30,4 x 22,5 cm, Rijksmuseum, Amsterdam, RP-P-1938-2064 LINKCredit: Rijksmuseum Amsterdam/ Legaat van de heer F.G. Waller, Amsterdam Public Domain Mark 1.0
Weiterführende Literatur
- Breuer, Ingo: „Kreativität der Saufteufel“, in: Die sieben Todsünden, hrsg. v. ders., Sebastian Goth, Björn Moll, Martin Roussel, Paderborn 2015, S. 343-378.
- Emmerling-Skala, Andreas: Bacchus in der Renaissance, 2 Bde., Hildesheim, 1994.
- Girometti, Stefania: In Italien Karriere machen. Der flämische Maler Michele Desubleo zwischen Rom, Bologna und Venedig (ca. 1624-1664), Heidelberg 2022.
- Heinz, Andreas/Daedelow, Laura S.: Alkohol als Kulturgut – eine historisch-anthropologische und therapeutische Perspektive auf Alkoholkonsum und seine soziale Rolle in westlichen Gesellschaften, in: Bundesgesundheitsblatt, 64 (2021), S. 646-651.
- Helmus, Liesbeth M.: De Bentvueghels – een berucht kunstgenootschap in Rome 1620-1720, Amsterdam 2023.
- Hoogewerff, Godefridus J.: De Bentvueghels, Den Haag 1952.
- Lottermoser, Martin: “Zu den Zeichnungen der Bentvuegehls im Dresdener Kupferstich-Kabinett“, in: Dresdener Kunstblätter, 67.3 (2023), S. 4-13.
- Mocny, Johanna: „hoe schilder hoe wilder – Alkoholkonsum von Malern in den Künstlerviten des Karel van Mander“, in: Metabolismen - Nahrungsmittel als Kunstmaterial, hrsg. v. Isabella Augart, Ina Jessen, Hamburg 2019, S. 145-160.
- Moffitt, John F.: Inspiration. Bacchus and the cultural history of a creation myth, Leiden 2005.
- Morel, Philippe: Renaissance dionysiaque. Imaginaire du vin et de la vigne dans l'art européen de la Renaissance, Paris 2015.
- Roberts, Benjamin B.: Sex, drugs and rock ‘n’ roll in the Dutch Golden Age, Amsterdam 2012.
- Tacke, Andreas: ”… auf Niederländische Manier“. Sandrarts römische Willkommensfest im Lichte der Künstlersozialgeschichte, Heidelberg 2009.
- Watzl, Hans/ Manfred V. Singer: „Alkohol und Alkoholismus: Kulturgeschichtliche Anmerkungen“, in: Alkohol und Alkoholfolgekrankheiten. Grundlagen, Diagnostik, Therapie, hrsg. v. Manfred V. Singer, Stephan Teyssen, Berlin 1999, S. 1-10.
Quellen
- Gool, Johan van: De Nieuwe Schouburg Der Nederlantsche Kunstschilders En Schilderessen, Band 2, Greevenhagen, 1751.
- Mander, Karel van: Het schilder-boeck, waerin voor eerst de leerlustighe iueght den grondt der edel vry schilderconst in verscheyden deelen wort voorghedraghen […], Haarlem 1604.
- Mander, Carel van: Das Leben der niederländischen und deutschen Maler (von 1400 bis ca. 1615), übersetzt von Hanns Floerke, München/ Leipzig 1906.
- Mander, Karel van: Das Lehrgedicht des Karel van Mander. Text, Übersetzung und Kommentar nebst Anhang über Manders Geschichtskonstruktion und Kunsttheorie, hrsg. v. Rudolf Hoecker, Den Haag, 1916.
- Rulant, H.: Satyra of Schimpdicht. Prijsende den Godt Bacchuys, of ’t Droncken drincken, Amsterdam 1632.
Expertinnen und Experten
Prof. Dr. Philippe Morel ist emeritierter Professor für Kunstgeschichte der Frühen Neuzeit an der Université Paris I Panthéon-Sorbonne. Seine Forschungsschwerpunkte liegen im Bereich der italienischen Kunst der Renaissance und des Manierismus, insbesondere auf magisch-astrologischen Bildwelten, auf der Vorstellungswelt der Grotesken, dionysischer Ikonographie sowie Fragen der Mystik und Bildwahrnehmung. Für die Podcastfolge besonders einschlägig ist sein Buch Renaissance dionysiaque. Imaginaire du vin et de la vigne dans l'art européen de la Renaissance (Paris 2015), das die Rolle der bacchantischen Inspiration in der europäischen Renaissancekunst untersucht.
Dr. Anna Magnago Lampugnani ist Wissenschaftliche Assistentin an der Bibliotheca Hertziana – Max-Planck-Institut für Kunstgeschichte in Rom. In ihren Forschungen beschäftigt sie sich hauptsächlich mit Themen der Kunsttheorie der Frühen Neuzeit, mit Rahmen und - und Ornamentphänomen sowie mit künstlerischen Austauschprozessen zwischen Spanien und Süditalien. Sie ist Autorin des für die Podcastfolge einschlägigen Buches Furor. Vorstellungen künstlerischer Eingebung in der Frühen Neuzeit (München 2020), in dem sie untersucht, welche Rolle der furor als Vorstellung von künstlerischer Eingebung für das frühneuzeitliche Verständnis von Kreativität spielte.
Credits
Autor: Vincent Ellmers
Redaktion, wissenschaftliche Betreuung und Lektorat: Dr. Jana Graul
Sprecherinnen und Sprecher: Vincent Ellmers (Sprecher), Prof. Dr. Phillipe Morel (Experte), Dr. Anna Magnago Lampugnani (Expertin), Miskatonic Theater Hamburg (Szenen), Justin Lange (Deutsches Voice Over Prof. Dr. Philippe Morel)
Schnitt und Sound: Vincent Ellmers
Grafik: Darius Wakilzadeh